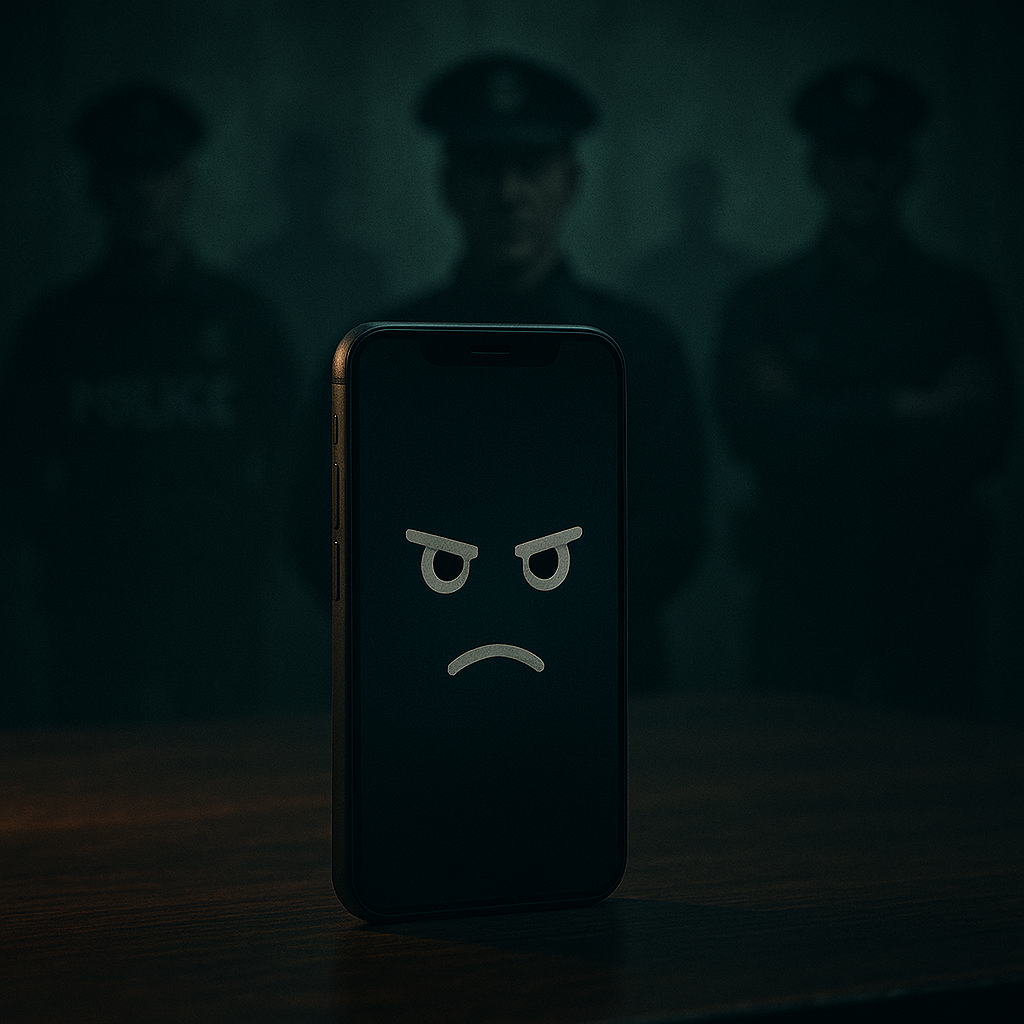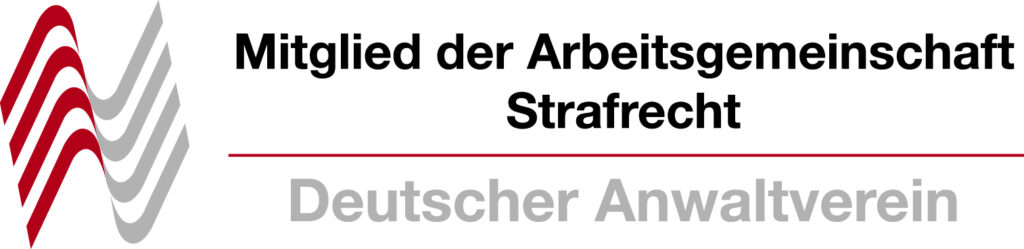Das eigene Telefon wird abgehört? Für viele Menschen klingt das wie ein Szenario aus einem Krimi. Doch die Überwachung der Telekommunikation ist in Deutschland unter bestimmten Voraussetzungen tatsächlich erlaubt – auch in Bremen, Niedersachsen oder bundesweit. Dabei handelt es sich allerdings um einen sehr tiefgreifenden Eingriff in die Privatsphäre, der rechtlich streng geregelt ist.
In diesem Beitrag erklären wir, unter welchen Umständen eine sogenannte Telekommunikationsüberwachung (TKÜ) zulässig ist, wie sie abläuft, welche Straftaten davon betroffen sein können – und was Beschuldigte tun sollten, wenn sie vermuten, im Visier der Ermittlungsbehörden zu stehen.
1. Rechtsgrundlage: Was erlaubt die Polizei?
Die zentrale rechtliche Grundlage für die TKÜ ist § 100a Strafprozessordnung (StPO). Danach darf die Telekommunikation von Beschuldigten nur dann überwacht werden, wenn ein konkreter Verdacht auf eine besonders schwere Straftat besteht – und selbst dann nur unter engen Voraussetzungen.
Wichtig: Die TKÜ greift in das Grundrecht auf das Fernmeldegeheimnis (Artikel 10 Grundgesetz) ein. Daher braucht es grundsätzlich einen richterlichen Beschluss. Nur in Gefahr-im-Verzug-Fällen kann die Staatsanwaltschaft die Maßnahme zunächst selbst anordnen – muss sie aber innerhalb von drei Werktagen richterlich bestätigen lassen (§ 100e StPO).
Die TKÜ wird in der Regel für drei Monate genehmigt und kann mehrfach um je weitere drei Monate verlängert werden.
2. Welche Straftaten rechtfertigen eine Telefonüberwachung?
Nicht jede Straftat reicht aus, um das Telefon einer Person abhören zu dürfen. Die StPO nennt in § 100a StPO eine abschließende Liste schwerer Delikte, bei denen eine TKÜ zulässig ist. Dazu zählen unter anderem:
- Straftaten gegen das Leben (z. B. Mord, Totschlag)
- Schwere Formen der Körperverletzung
- Sexualdelikte, insbesondere gegen Kinder (§§ 176 ff. StGB)
- Terrorismus und staatsgefährdende Delikte
- Menschenhandel und Schleusungskriminalität
- Schwere Eigentumsdelikte, z. B. besonders schwerer Diebstahl, bandenmäßiger Betrug
- Korruption und Bestechlichkeit
- Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz, etwa der gewerbsmäßige Handel mit Drogen oder das Handeltreiben in nicht geringer Menge
Voraussetzung ist immer, dass die Straftat im konkreten Fall von erheblicher Bedeutung ist und dass andere Ermittlungsmaßnahmen keinen Erfolg versprechen oder wesentlich erschwert wären.
3. Wie läuft eine TKÜ praktisch ab?
In der Praxis beginnt alles mit einem Antrag: Die Polizei stellt auf Basis ihrer bisherigen Erkenntnisse über die Staatsanwaltschaft einen Antrag beim zuständigen Amtsgericht. Dieses prüft – teils oberflächlich – die Voraussetzungen und erlässt bei Vorliegen der Bedingungen einen Beschluss.
Dann wird der jeweilige Telekommunikationsanbieter kontaktiert. Dieser stellt technische Daten wie Rufnummer, SIM-Karten-Nummer oder IMEI zur Verfügung und leitet die Gespräche oder Textnachrichten zur Auswertung an die Ermittlungsbehörden weiter.
Die Polizei dokumentiert im Anschluss die Inhalte der Kommunikation, sofern diese für das Verfahren relevant sind – sie gelangen als Protokolle in die Ermittlungsakte.
4. Neue Formen der Überwachung: Quellen-TKÜ und Online-Durchsuchung
Seit einigen Jahren können Ermittlungsbehörden auch auf digitale Inhalte zugreifen, die über klassische Telefonate hinausgehen. Hierzu zählen:
- Quellen-TKÜ: Eine Software wird auf dem Endgerät (Smartphone, Tablet, Laptop) installiert, um Kommunikation vor oder nach der Verschlüsselung mitzulesen. Diese Form betrifft z. B. verschlüsselte Messenger wie WhatsApp oder Signal.
- Online-Durchsuchung: Dabei greift die Polizei mit einem sogenannten „Staatstrojaner“ auf das gesamte Gerät zu – inklusive gespeicherter Dateien, Bilder und Nachrichten.
Beide Maßnahmen dürfen nur bei besonders schweren Straftaten angewandt werden und spielen bisher eine untergeordnete Rolle. Dennoch zeigt sich: Die Möglichkeiten der Ermittlungsbehörden wachsen stetig.
5. Was sollten Beschuldigte tun, wenn sie eine Überwachung vermuten?
Der Gedanke, überwacht zu werden, ist beunruhigend – umso wichtiger ist es, kühlen Kopf zu bewahren. Wer glaubt, dass gegen ihn oder sie ermittelt wird, sollte unbedingt folgende Schritte beachten:
- Keine Angaben gegenüber der Polizei machen – auch nicht „informell“ oder am Telefon. Das Aussageverweigerungsrecht gilt uneingeschränkt.
- Keine Details zu möglichen Vorwürfen über das eigene Handy oder Internet teilen.
- Rechtsanwält:in einschalten – und zwar so früh wie möglich. Nur so kann sichergestellt werden, dass rechtzeitig Akteneinsicht genommen und eine fundierte Verteidigungsstrategie entwickelt wird.
- Nicht in Panik das Telefon oder die SIM-Karte wechseln – die Polizei kann Geräte über IMEI-Nummern und Standortdaten identifizieren. Auch sogenannte IMSI-Catcher kommen zum Einsatz.
In vielen Fällen stellt sich später heraus, dass die TKÜ rechtlich nicht zulässig war oder die gesammelten Daten nicht verwertbar sind. Ein voreiliges Geständnis – etwa unter dem Druck vermeintlicher Beweise – kann also fatale Folgen haben.
Fazit: TKÜ ist ein massiver Eingriff – aber nicht grenzenlos erlaubt
Telekommunikationsüberwachung ist ein scharfes Schwert der Strafverfolgung – aber es darf nicht beliebig eingesetzt werden. Für Beschuldigte ist entscheidend, frühzeitig anwaltliche Unterstützung in Anspruch zu nehmen, um die eigenen Rechte zu wahren.
Als Kanzlei mit Standorten in Bremen, Sulingen und Osnabrück beraten wir Sie kompetent, diskret und auf Augenhöhe – auch online. Wenn Sie erfahren haben, dass gegen Sie eine TKÜ-Maßnahme läuft oder Sie eine Überwachung vermuten, stehen wir Ihnen mit unserer strafrechtlichen Erfahrung zur Seite.
FAQ’s zum Thema Handyüberwachung
1. Wann darf die Polizei mein Telefon abhören?
Nur bei Verdacht auf besonders schwere Straftaten, z. B. Mord, schwerer Betrug, organisierte Kriminalität oder Verstöße gegen das BtMG – und nur mit richterlicher Anordnung.
2. Muss ich vorher informiert werden, wenn mein Telefon überwacht wird?
Nein. Die TKÜ findet verdeckt statt. In vielen Fällen erfahren Betroffene erst nach Abschluss der Ermittlungen davon – wenn überhaupt.
3. Kann ich technisch erkennen, ob mein Handy überwacht wird?
Nein. Geräusche wie Knacken oder Klicken sind kein Hinweis auf eine Überwachung. Auch der SIM-Kartenwechsel bringt keine Sicherheit.
4. Was ist der Unterschied zwischen TKÜ, Quellen-TKÜ und Online-Durchsuchung?
TKÜ: Abhören klassischer Gespräche/SMS.
Quellen-TKÜ: Überwachung von verschlüsselter Kommunikation durch Spyware.
Online-Durchsuchung: Zugriff auf alle Daten auf dem Gerät durch eine staatliche Software.
5. Was sollte ich tun, wenn ich eine Überwachung vermute?
Nicht reden – sondern schweigen und anwaltliche Hilfe suchen. Die Kanzlei Witte & Steveker unterstützt Sie diskret und kompetent.