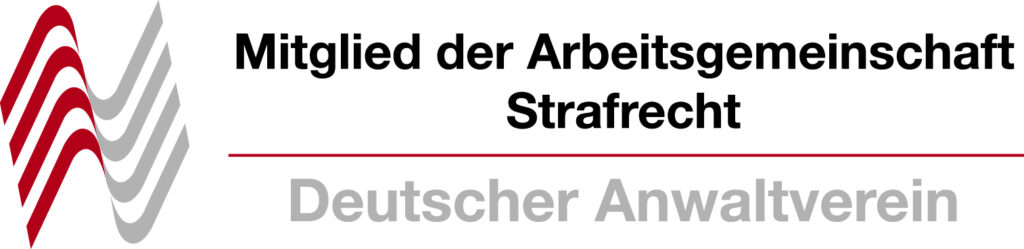Urteil des Landgerichts Verden vom 29.04.2025 (7 O 95/24)
1. Das Versäumnisurteil vom 29.10.2024 (Az. 7 O 95/24) wird aufrechterhalten.
2. Die Beklagte trägt auch die weiteren Kosten, mit Ausnahme der Kosten der Nebenintervention. Diese tragen die Nebenintervenienten selbst.
3. Die Vollstreckung darf nur gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110% des jeweils zu vollstreckenden Betrages begonnen oder fortgesetzt werden.
4. Der Streitwert wird auf die Wertstufe bis 10.000 € festgesetzt.
Tatbestand:
Die Parteien streiten um Ansprüche im Zusammenhang mit einem Stromspeicher.
Die Parteien schlossen im August 2021 einen Vertrag über die Lieferung und Installation einer Photovoltaikanlage, die Abwicklung mit dem Energieversorger sowie einen Kaufvertrag über einen Stromspeicher, Senec Home V3 hybrid duo mit einer Speicherkapazität von 5,0 kWh. Der Stromspeicher wurde im August 2021 geliefert. Die Beklagte rechnete in Höhe eines Betrages von insgesamt brutto 17.187,88 € ab. In diesem Gesamtbetrag waren 9.508,10 € für den Stromspeicher enthalten.
Es kam in Deutschland zu mehreren Bränden der Speicher des Herstellers Senec. In Presseberichten des Herstellers heißt es u.a.:
„Im März 2022 musste Senec nach drei Zwischenfällen rund 60.000 Homespeicher-Anlagen zwangsabschalten. Es war zu mehreren Bränden in Häusern gekommen. Über Monate dauerte es, bis die Verbraucher wieder in ihren Speichern über die komplette Kapazität verfügen konnten. Senec versucht seitdem, mit einer SmartGuard-Technologie die Probleme in den Griff zu bekommen. Bevor es zu Bränden kommt, soll die Technologie dafür Sorge tragen, dass das Modul abgeschaltet wird. Im Keller eines Zweifamilienhauses kam es am 19. März 2023 in Burladingen zu einem Brand eines Solarspeichers. Als Reaktion darauf reduzierte Senec am 20. März 2023 die Leistung vieler seiner Speicher, um die Brandgefahr zu verringern. Im August 2023 gab es Probleme mit Senec-Speicher in Mittelfranken und Niedersachsen. Hier standen vor allem die Speicher der Bauarten „SENEC.Home V2.1“ und „SENEC.Home V3“ im Mittelpunkt. Die Kapazität der Stromspeicherung wurde auf rund 70 % begrenzt, nachdem es zu Bränden in einem Haus und einer Garage gekommen war. Zwei weitere Brände wurden berichtet, wobei die Suche nach der Ursache noch andauerte. Der Hersteller Senec hat auf seiner Website am 30. August 2023 über den Konditionierungsbetrieb informiert, bei dem die Kapazität der betroffenen Modelle auf etwa 70 % beschränkt wurde. Ferner wurden bei einigen Produkten Fernabschaltungen durchgeführt, insbesondere bei den Modellen SENEC.home V2 und V3, die Zellmodule des Herstellers BMZ enthalten, bei denen es zu Kurzschlüssen kam.“
Der Hersteller versetzte sämtliche Stromspeicher aufgrund dessen in den sogenannten Konditionierungsbetrieb, was zu einer Reduzierung der Speicherkapazität führte. Der Speicher des Klägers wurde aufgrund des Brandrisikos zeitweise, u. a. im Zeitraum April bis Juli 2023, per Fernabschaltung vollständig deaktiviert. Der streitgegenständliche Stromspeicher des Klägers lief zum Zeitpunkt der Klageerhebung mit reduzierter Leistung. Mittlerweile ist der Speicher per Fernabschaltung vollständig abgeschaltet worden.
Der Hersteller teilte hierzu u.a. mit:
„(…) SENEC.SmartGuard hat Ihren Stromspeicher geregelt in die Fernabschaltung versetzt. (…) Unser System prüft ständig die Betriebsdaten des Speichers und sowie mit den Betriebsdaten aller Speicher in unserer Batterie-Cloud. Sollte SENEC.SmartGuard auf einem dieser Wege Auffälligkeiten bei einem Speicher feststellen, geht diese Anlage für eine ausführliche, individuelle Prüfung des Systems automatisch in die Fernabschaltung. Dieser Fall ist bei Ihrem Stromspeicher eingetreten. Diese Prüfung kann einige Zeit dauern. Das Ergebnis der Prüfung kann sein, dass der Speicher wieder in einen begrenzten Betrieb gehen kann. Das Ergebnis der Prüfung kann aber auch sein, dass Ihr System in der Fernabschaltung verbleibt. (…)“
Der Kläger erhält aufgrund der Kapazitätsbeschränkung bzw. Abschaltung des Speichers eine Entschädigung vom Hersteller.
Der mangelhafte Zustand wurde von dem Kläger wiederholt moniert. Am 20.07.2023 tauschte die Beklagte eine von zwei in dem Batteriespeicher verbauten Batterien aus. Dem Kläger wurde mitgeteilt, dass auch die zweite Batterie noch ausgetauscht werden sollte. Dies geschah allerdings nicht. Der Kläger forderte die Beklagte dann mit Schreiben vom 08.11.2023 schriftlich auf, bis zum 29.11.2023 eine Lösung zu finden und drohte den Rücktritt vom Kaufvertrag an.
Im November entschloss sich der Hersteller des Speichers dazu, den betroffenen Kunden einen kostenlosen Austausch der Speicher anzubieten. Dies sollte ab dem 1. Quartal 2024 erfolgen. Hierüber wurde der Kläger vom Geschäftsführer der Beklagten, Herrn, informiert. Die Beklagte wies sodann mit einem undatierten Schreiben die klägerischen Ansprüche zurück. Mit Anwaltsschreiben vom 22.12.2023 erklärte der Kläger den Rücktritt vom Kaufvertrag und forderte zur Rückzahlung unter Fristsetzung auf. Mit Schreiben vom 24.01.2024 wurde der Rückzahlungsanspruch zurückgewiesen.
Der Kläger behauptet, die ganze Serie der Stromspeicher sei mangelhaft. Auch der Speicher des Klägers sei aufgrund des Sicherheitsrisikos mangelhaft. Die Kapazitätsreduzierung stelle eine Abweichung der Ist- von der Sollbeschaffenheit dar. Es bestehe außerdem eine Brandgefahr. Die Beklagte habe die Mangelhaftigkeit auch anerkannt. Der Geschäftsführer der Beklagten habe dem Kläger zugesichert, den Speicher kurzfristig vollständig auszutauschen.
Der Kläger hat beantragt, 1. die Beklagte zu verurteilen, an den Kläger 9.508,10 € brutto nebst Verzugszinsen von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatzseit dem 30.11.2023 zu zahlen; dies Zug-um-Zug gegen Rücknahme des Senec Home V3 hybrid duo (5,0 KW Speicherkapazität) und 2. die Beklagte zu verurteilen, an den Kläger 973,66 € nebst Verzugszinsen von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz ab Rechtshängigkeit zu zahlen sowie 3. festzustellen, dass die Beklagte sich mit der Rücknahme des im Klageantrag zu Ziffer 1) benannten Senec Home V3 hybrid duo (5,0 KW Speicherkapazität) jedenfalls seit dem 8. Januar 2024 in Verzug befindet. Nachdem der Prozessbevollmächtigte der Beklagten im Termin am 29.10.2024 nicht aufgetreten ist, hat das Gericht die Beklagte mit Versäumnisurteil vom selben Tag antragsgemäß verurteilt. Gegen das am 05.11.2024 zugestellte Versäumnisurteil hat die Beklagte mit Schriftsatz vom 19.11.2024 Einspruch eingelegt und der Uwe € Co. sowie der Senec den Streit verkündet. Die Senec ist dem Rechtsstreit mit Schriftsatz vom 27.11.2024 auf Seiten der Beklagten beigetreten. Die Uwe € Co. ist dem Rechtsstreit mit Schriftsatz vom 17.12.2025 auf Seiten der Beklagten beigetreten.
Der Kläger beantragt nunmehr,
das Versäumnisurteil vom 29.10.2024 aufrechtzuerhalten und den Beklagten antragsgemäß zu verurteilen.
Die Beklagte beantragt,
das Versäumnisurteil vom 29.10.2024 aufzuheben und die Klage abzuweisen.
Die Nebenintervenientin zu 1. beantragt,
das Versäumnisurteil aufzuheben, die Klage abzuweisen und dem Kläger auch die weiteren Kosten der Nebenintervenientin aufzuerlegen.
Die Nebenintervenientin zu 2. schließt sich dem Antrag der Nebenintervenientin zu 1. an.
Die Beklagte meint, der Konditionierungsbetrieb stelle keinen Mangel dar. Es handele sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme. Es fehle schon an Anknüpfungspunkten zur Mangelhaftigkeit des klägerischen Speichers, da schon nach dem Klägervortrag lediglich 3 von 60.000 Speichern betroffen gewesen seien. Die Beklagte behauptet, innerhalb der vom Kläger gesetzten Frist bis zum 29.11.2023 habe der Kläger das vom Hersteller angekündigte Vorgehen ausdrücklich akzeptiert. Er habe wörtlich reagiert mit „Dann warten wir das mal ab“.
Die Nebenintervenientin zu 2. erhebt die Einrede der Verjährung.
Für die weiteren Einzelheiten des Parteivortrages wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.
Das Gericht hat den Kläger sowie den Geschäftsführer der Beklagten, Herrn , informatorisch angehört. Insoweit wird auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 29.04.2025 Bezug genommen.
Entscheidungsgründe:
A.
Der statthafte und auch sonst zulässige Einspruch der Beklagten gegen das Versäumnisurteil vom 29.10.2025 hat den Rechtsstreit gemäß § 342 ZPO in die Lage vor der Säumnis versetzt.
B.
In der Sache führt der Einspruch der Beklagten jedoch nicht zum Erfolg, da die zulässige Klage begründet ist.
I.
Der Kläger hat gegen die Beklagte nach seinem teilweisen Rücktritt einen Anspruch auf Rückzahlung des entrichteten Bruttokaufpreises in Höhe von 9.508,10 € Zug um Zug gegen Übergabe des streitgegenständlichen Batteriespeichers aus §§ 433 Abs.1, 434 Abs. 1, 2 Nr. 1, 2, 437 Nr. 2, 323 Abs. 1, 346 Abs. 1, 348 BGB.
1.
Bei dem streitgegenständlichen Vertrag über die Lieferung, Montage und Inbetriebnahme einer Photovoltaikanlage handelt es sich um einen Kaufvertrag mit Montageverpflichtung, auf den die §§ 433 ff. BGB Anwendung finden.
Für die hier vorzunehmende Abgrenzung zwischen einem Kaufvertrag mit Montageverpflichtung und einem Werkvertrag kommt es darauf an, auf welcher der beiden Leistungen bei der gebotenen Gesamtbetrachtung der Schwerpunkt liegt. Dabei ist vor allem auf die Art des zu liefernden Gegenstands, das Wertverhältnis von Lieferung und Montage sowie auf die Besonderheiten des geschuldeten Ergebnisses abzustellen (BGH NJW 2014, 845; BGH NJW-RR 2004, 850). Nach der neueren Rechtsprechung kommt eine Einordnung als Werkvertrag dann in Betracht, wenn die Verpflichtungen des Unternehmers auf die Durchführung aufwändiger, handwerklicher Installations- und Anpassungsarbeiten gerichtet sind und dies dem Vertrag die maßgebliche Prägung gibt (BGH NZBau 2016, 558 Rn. 11; vgl. auch OLG Frankfurt Urt. v. 6.5.2019 – 29 U 199/16; OLG München BeckRS 2020, 5624 Rn. 17; OLG München NJW 2014, 867, 868).
Dies ist vorliegend jedoch nicht der Fall, weshalb der streitgegenständliche Vertrag als Kaufvertrag mit Montageverpflichtung zu qualifizieren ist. Der Schwerpunkt des streitgegenständlichen Vertrages liegt in der Lieferung der Photovoltaikmodule und des Batterieheimspeichers, nicht in der Montage und Installation. Dass die Beklagte hier aufwändige Installations- oder auch Anpassungsarbeiten durchgeführt hat, ist aus dem Parteivortrag schon nicht ersichtlich.
2.
Der Kläger ist nach § 437 Nr. 2, 323 Abs. 1 BGB wirksam teilweise von dem zwischen den Parteien geschlossenen Vertrag zurückgetreten.
a)
Der Kläger ist mit Anwaltsschreiben vom 22.12.2024 wirksam teilweise von dem mit der Beklagten geschlossenen Vertrag zurückgetreten. Zwar spricht weder die Klageschrift noch das vorgenannte Schreiben ausdrücklich von einem Teilrücktritt, allerdings wurde lediglich der auf den Batteriespeicher fallende Kaufpreis von 9.508,10 € Zug um Zug gegen Rückgabe des Speichers gefordert, sodass davon auszugehen ist, dass sich die Rücktrittserklärung jedenfalls konkludent ausschließlich auf den streitgegenständlichen Batteriespeicher bezieht.
b)
Auch die übrigen Voraussetzungen des Teilrücktritts liegen vor.
(aa)
Der streitgegenständliche Batteriespeicher ist mangelhaft im Sinne des § 434 Abs. 1 und 2 BGB, weil er derzeit und auf nicht absehbare Zeit nicht die vertraglich vereinbarte Leistungskapazität aufweist und somit die subjektiven Anforderungen nicht erfüllt. Gemäß § 434 Abs. 1 BGB ist die Sache frei von Sachmängeln, wenn sie bei Gefahrübergang den subjektiven Anforderungen, den objektiven Anforderungen und den Montageanforderungen dieser Vorschrift entspricht. Den subjektiven Anforderungen i.S.d. § 434 Abs. 2 BGB entspricht die Sache, wenn sie die vereinbarte Beschaffenheit hat, sich für die nach dem Vertrag vorausgesetzte Verwendung eignet und mit dem vereinbarten Zubehör und den vereinbarten Anleitungen, einschließlich Montage- und Installationsanleitungen, übergeben wird. Zu der vereinbarten Beschaffenheit gehört unter anderem auch die Funktionalität der Sache.
(1)
Dem streitgegenständlichen Speicher fehlt die vereinbarte Beschaffenheit. Unstreitig war eine Speicherkapazität von 5,0 kWh vereinbart. Der streitgegenständliche Batteriespeicher ist allerdings so beschaffen, dass sich die Nebenintervenientin zu 2) zu einer Reduzierung der Speicherkapazität bzw. Abschaltung entschieden hat und dem Kläger daher derzeit und zumindest auf derzeit unabsehbare Zeit nicht die vertraglich vereinbarte Speicherleistung 5,0 kWh zur Verfügung steht.
Infolge der Reduzierung der Speicherkapazität fehlt dem streitgegenständlichen Batterieheimspeicher eine vereinbarte Beschaffenheit (so auch LG Bielefeld, Urteil vom 5. Dezember 2024 – 9 O 212/24 –, Rn. 29, juris).
(2)
Dem kann die Beklagte nicht mit Erfolg entgegenhalten, dass nur vereinzelte Speicher von den Brandereignissen betroffen gewesen sind. Denn die durch die Nebenintervenientin zu 2. vorgenommene Drosselung der Speicherkapazität betrifft nicht ausnahmslos sämtliche von ihr hergestellten Solarstromspeicher, sondern nur Speicher bestimmter Baureihen. Der Sachmangel des durch den Kläger erworbenen Speichers besteht darin, dass er zu einer dieser Baureihen gehört und aufgrund der in ihm verbauten Komponenten die Nebenintervenientin zu 2) als Herstellerin veranlasste, ihn aus Sicherungsgründen in einen eingeschränkten Betrieb zu versetzen. Damit ist der Speicher (ohne einen Austausch der Batteriemodule) technisch nicht für einen Betrieb mit der vertraglich vereinbarten Maximalleistung ausgelegt. Für die Einordnung als Mangel kommt es auch nicht darauf an, wer den abweichenden Zustand veranlasst oder verursacht hat. Jede Abweichung der „Ist-Beschaffenheit“ von der „Soll-Beschaffenheit“ begründet einen Sachmangel (vgl. LG Bielefeld, Urteil vom 5. Dezember 2024 – 9 O 212/24 –, Rn. 30, juris).
Ob die Brandgefahr auch tatsächlich für den streitgegenständlichen Speicher anzunehmen ist, kann im Hinblick auf die Abweichung von den subjektiven Anforderungen dahinstehen.
(3)
Ebenfalls ohne Relevanz für die Beurteilung der Mangelhaftigkeit des Speichers ist der Umstand, dass der Kläger für die Dauer der Kapazitätsbeschränkung eine Kompensation des Herstellers erhält, da Gegenstand der Beschaffenheitsvereinbarung nicht ein bestimmter zu erzielender Betrag ist, sondern eine konkrete Speicherleistung.
cc)
Der Mangel war auch bereits bei Gefahrübergang vorhanden.
Zwar stand dem Kläger nach Montage und Installation zunächst für einige Zeit die vereinbarte Speicherkapazität zur Verfügung. Allerdings beruhte die vorgenommene Beschränkung der Speicherkapazität nicht auf dem Eintritt einer nachträglichen negativen Veränderung, sondern auf dem Umstand, dass der Speicher einer Baureihe angehört, hinsichtlich derer der Hersteller sich zunächst ohne Einzelfallprüfung für den Konditionierungsbetrieb entschieden hat. Die für diese Entscheidung maßgeblichen Bauteile waren von Anfang an in dem streitgegenständlichen Speicher verbaut und auch zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs bereits vorhanden. Die nach Gefahrübergang vorgenommene Drosselung der Speicherkapazität war damit schon zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs angelegt (so auch LG Bielefeld, Urteil vom 5. Dezember 2024 – 9 O 212/24 –, Rn. 32, juris).
dd)
Der Kläger hat die Beklagte erfolglos zur Nacherfüllung aufgefordert. Unstreitig hatte der Kläger bereits 2023 mehrfach die Mängel gegenüber der Beklagten gerügt. Der im Juli 2023 erfolgte Austausch einer der zwei verbauten Batterien hat nicht zu einer Beseitigung des Mangels geführt.
Soweit der Kläger die Beklagte dann im November 2023 unter Fristsetzung aufgefordert hat, eine Lösung zu finden, genügt dies als hinreichende Nacherfüllungsfrist im Sinne des § 323 Abs. 1 BGB. Auch wenn in dem handschriftlichen Schreiben nicht ausdrücklich um „Nachbesserung“ oder „Nacherfüllung“ ersucht worden ist, wird durch das Schreiben hinreichend deutlich, dass der Kläger die Behebung des gerügten Mangels begehrt. Dies erfolgte innerhalb der gesetzten Frist nicht.
ee)
Der Teilrücktritt war nicht nach § 323 Abs. 5 Satz 2 BGB ausgeschlossen. Die Pflichtverletzung der Beklagten war nach einer umfassenden Interessenabwägung nicht unerheblich im Sinne von § 323 Abs. 5 Satz 2 BGB.
Die Beantwortung der Frage, ob eine Pflichtverletzung unerheblich im Sinne des § 323 Abs. 5 Satz 2 BGB ist, erfordert eine umfassende Interessenabwägung, in deren Rahmen ein Verstoß gegen eine Beschaffenheitsvereinbarung allerdings regelmäßig die Erheblichkeit der Pflichtverletzung indiziert (vgl. BGH, Urteil vom 06.02.2013, VIII ZR 374/11, juris, Rn. 16). Das gilt auch im vorliegenden Fall. Denn die maximale Speicherkapazität eines Solarstromspeichers bestimmt nicht nur dessen Wert, sondern auch dessen Nutzen für den Kläger. Die Reduzierung der Speicherleistung führt dazu, dass er den selbst produzierten Strom nicht in dem bei Vertragsabschluss vorausgesetzten Maß speichern und für eigene Zwecke verbrauchen, sondern überschüssige Erträge der Photovoltaikanlage nur in das Netz einspeisen kann. Zugleich muss er seinen eigenen Bedarf umfangreicher als bei Vertragsschluss geplant durch die Inanspruchnahme von Strom aus dem Netz decken.
Dass die Nebenintervenientin zu 2) als Kulanzleistung den finanziellen Ausgleich der damit einhergehenden finanziellen Nachteile anbietet, mildert die auf Seiten des Klägers bestehenden Beeinträchtigungen ab, führt aber nicht dazu, dass die Pflichtverletzung der Beklagten als unerheblich angesehen werden könnte. Dasselbe gilt für den seitens der Nebenintervenientin zu 2) Anfang November 2023 für die Zeit ab Sommer 2024 in Aussicht gestellten Austausch der durch den Konditionierungsbetrieb betroffenen Batteriemodule.
ff)
Der Rücktritt ist auch nicht aufgrund einer dahingehenden Vereinbarung zwischen den Parteien ausgeschlossen.
Soweit die Beklagte behauptet, man habe sich darauf geeinigt, dass zunächst der Austausch durch den Hersteller abgewartet werden soll, vermag sich das Gericht nach Anhörung des Klägers und des Geschäftsführers der Beklagten, Herrn , nicht mit der erforderlichen Gewissheit davon überzeugen, dass der Kläger für einen unbekannten Zeitraum auf die Geltendmachung seiner gesetzlichen Mängelgewährleistungsrechte verzichten wollte. Die Angaben der Parteien in der mündlichen Verhandlung am 29.04.2025 widersprechen sich. Beide Schilderungen sind für sich genommen plausibel, sodass das Gericht der Sachverhaltsschilderung des Herrn nicht den Vorrang gegenüber der Schilderung des Klägers einzuräumen vermag.
c)
Der Kläger hat nach § 346 Abs. 1 BGB einen Anspruch auf Rückzahlung der anteiligen Vergütung in Höhe von 9.508,10 € für den Solarstromspeicher Zug um Zug gegen Rückgabe des Speichers.
Die von der Nebenintervenientin zu 2. geforderte Anrechnung von Nutzungsvorteilen nach § 346 Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1 BGB auf die dem Kläger zu erstattende Vergütung kommt vorliegend nicht in Betracht. Selbstständige wechselseitige Ansprüche können zwar automatisch zu saldieren sein. Das ist etwa nach der Saldotheorie bei der bereicherungsrechtlichen Rückabwicklung eines (Kauf-)Vertrags der Fall (BGH, NJW 2014, 854 = ZfIR 2014, 51 Rn. 28). Bei den wechselseitigen Rückgewähransprüchen nach dem Rücktritt einer Partei gem. § 346 BGB, um den es hier geht, verhält es sich aber anders. Sie stehen unabhängig nebeneinander und sind nach § 348 S. 1 BGB Zug um Zug zu erfüllen, was eine automatische Saldierung ausschließt (BGHZ 115, 47 [56] = NJW 1991, 2484 und BGH, NJW 2016, 2428 = WM 2016, 454 Rn. 16; Staudinger/Kaiser, BGB, Neubearb. 2012, § 348 Rn. 2; vgl. auch BGH, BGHZ 178,182 = NJW 2009, 63 Rn. 29 f.). Sie können deshalb in getrennten Prozessen geltend gemacht werden. Macht eine Vertragspartei in dem Rückgewährprozess der anderen gegen sie ihren eigenen Rückgewähranspruch nicht geltend, kann sie dies in einem Folgeprozess nachholen (BGH, NJW 2010, 146 = WM 2010, 275 Rn. 20). Zu einer Saldierung kommt es nur, wenn die Aufrechnung ausdrücklich oder durch eine entsprechende Antragstellung konkludent erklärt wird (ein solcher Fall lag etwa dem Urteil BGHZ 175, 286 = NJW 2008, 2028 Rn. 3, 23 zugrunde) oder wenn der Käufer seinen Schaden unter Anrechnung der Gegenansprüche des Verkäufers berechnet. Dies ist vorliegend nicht geschehen. Hinsichtlich der Ausführungen der Nebenintervenientin zu 2) wird auf § 67 ZPO Bezug genommen.
3.
Auch die von der Nebenintervenientin zu 2. erhobene Einrede der Verjährung bleibt erfolglos. Vorliegend findet die zweijährige Verjährungsfrist für kaufvertraglichen Mängelrechte Anwendung, die mit Ablieferung der Sache beginnt, § 438 Abs. 1, Abs. 2 BGB. Diese Frist ist allerdings durch die unstreitigen Verhandlungen der Parteien über den Mangel nach § 203 BGB gehemmt worden.
Schweben zwischen dem Schuldner und dem Gläubiger Verhandlungen über den Anspruch oder die den Anspruch begründenden Umstände, so ist die Verjährung gehemmt, bis der eine oder der andere Teil die Fortsetzung der Verhandlungen verweigert. So ist unstreitig noch während der laufenden Verjährungsfrist im Juli 2023 angekündigt worden, auch noch die zweite Batterie auszutauschen. Soweit der Kläger dies zunächst abgewartet hat, ist noch nicht von einer Beendigung der Verhandlungen durch das „Einschlafen lassen“ auszugehen. Vielmehr durfte der Kläger zunächst abwarten, ob die Beklagte den von ihr angekündigten Austausch vornehmen wird. Diese Verhandlungen wurden dann durch das handschriftliche Schreiben des Klägers fortgesetzt und dauerten zumindest bis zur Zurückweisung des Rückzahlungsanspruchs mit Schreiben vom 24.01.2024 an. Die Verjährung konnte nach § 203 S. 2 BGB frühestens drei Monate nach dem Ende der Hemmung eintreten, also frühestens am 24.04.2024. Die Verjährung ist allerdings dann nach § 204 Abs. 1 Nr. 1 BGB durch Klageerhebung gehemmt worden. Die am 09.04.2024 anhängig gemachte Klage ist dem Beklagten ausweislich des Empfangsbekenntnisses auf Bl. 28 d.A. am 24.04.2024 zugestellt worden.
II.
Der Zinsanspruch folgt aus §§ 286 Abs. 1, 288 Abs. 1 BGB. Der Verzug ergibt sich bereits aus einer sog. Selbstmahnung der Beklagten. So bestätigte der Geschäftsführer der Beklagten, Herr , im Rahmen seiner informatorischen Anhörung, dass er dem Kläger zugesagt hatte, einen Austausch vorzunehmen, rückte sodann aber – nach eigenem Vortrag noch während der vom Kläger gesetzten Frist – hiervon wieder ab. Die Beklagte befand sich somit zumindest am 30.11.2023 bereits in Verzug.
III.
Weiterhin hat der Kläger gegen die Beklagte einen Anspruch auf Erstattung der vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten in der geltend gemachten Höhe von 973,66 € aus §§ 280 Abs. 1, 249 BGB. Die Einschaltung eines Rechtsanwalts war angesichts der Komplexität des Sachverhalts zur Durchsetzung der geltend gemachten Ansprüche erforderlich und zweckmäßig. Unter Zugrundelegung eines vorprozessualen Geschäftswerts von 9.508,10 € ergibt sich ausgehend von einer 1,3 Geschäftsgebühr zuzüglich Auslagenpauschale und Mehrwertsteuer im Rahmen der nach dem RVG erstattungsfähigen Gebühren ein Betrag in der geltend gemachten Höhe. Der Anspruch der Klägerin auf die hinsichtlich der vorgerichtlichen Rechtsanwaltsgebühren zuerkannten Rechtshängigkeitszinsen ergibt sich aus §§ 291, 288 Abs. 1 Satz 2 BGB.
IV.
Die Klage ist auch in Bezug auf das mit dem Klageantrag zu 3 geltend gemachte Feststellungsbegehren zulässig und begründet. Das nach § 256 ZPO erforderliche Feststellungsinteresse ergibt sich aus der Regelung des § 756 ZPO.
C. Die prozessualen Nebenentscheidungen finden ihre Grundlage in den §§ 91, 101 Abs. 1, 709 ZPO.
D.
Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 3 ZPO, § 48 G.