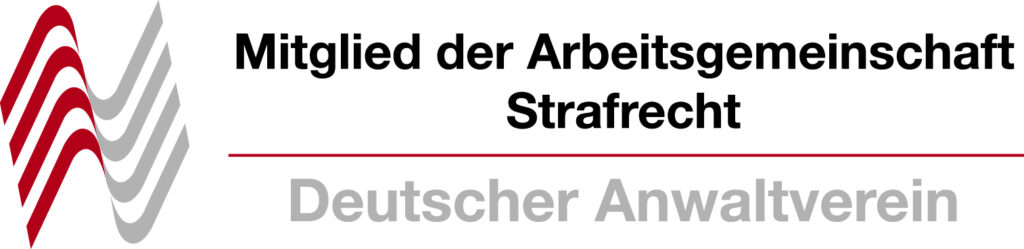Handyentsperrung mit Fingerabdruck durch die Polizei – was der BGH entschieden hat
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat eine lange diskutierte Rechtsfrage geklärt: Unter bestimmten Voraussetzungen dürfen Ermittlungsbehörden den Finger eines Beschuldigten zwangsweise auf den Fingerabdrucksensor seines Smartphones legen, um dieses zu entsperren. Das aktuelle Urteil (BGH, Beschluss vom 13.03.2025 – 2 StR 232/24) hat erhebliche Bedeutung für die Praxis – und wirft zugleich neue Fragen zum Schutz der eigenen Daten auf.
Im Folgenden beleuchten wir die juristischen Grundlagen, den praktischen Ablauf solcher Maßnahmen und die Risiken für Beschuldigte.
1. Juristische Grundlage: § 81b StPO in Verbindung mit §§ 94 ff. StPO
Der BGH stützt die Zulässigkeit auf § 81b Abs. 1 Strafprozessordnung (StPO) in Verbindung mit den Vorschriften über die Sicherstellung und Beschlagnahme (§§ 94 ff. StPO).
§ 81b StPO erlaubt erkennungsdienstliche Maßnahmen zur Durchführung eines Strafverfahrens – nach Auffassung des Gerichts gehört dazu auch das Auflegen eines Fingers auf den Sensor.
§§ 94 ff. StPO regeln, dass Beweismittel, wie gespeicherte Daten auf einem Handy, beschlagnahmt werden dürfen.
Voraussetzung ist stets eine richterliche Anordnung der Durchsuchung (§§ 102, 105 StPO), in der die Sicherstellung von Mobiltelefonen ausdrücklich genannt ist.
Besonders wichtig: Die Selbstbelastungsfreiheit schützt nach Ansicht des Gerichts nur vor aktiver Mitwirkung – nicht vor dem bloßen Dulden von Zwangsmaßnahmen.
2. Praktischer Ablauf der zwangsweisen Fingerabdruckentsperrung
In der Praxis sieht das so aus:
Ermittlungsbeschluss: Zunächst muss ein richterlicher Beschluss zur Durchsuchung und Sicherstellung vorliegen.
Weigerung des Beschuldigten: Sperren sich die Beschuldigten gegen die freiwillige Entsperrung, kann die Polizei den Finger zwangsweise auflegen.
Datensicherung: Die gefundenen Daten können durchsucht (§ 110 StPO) und beschlagnahmt werden.
Verwertung im Verfahren: Das Gericht kann diese Beweise grundsätzlich verwerten, selbst wenn um die Rechtsgrundlage gestritten wird – wie der BGH ausdrücklich feststellte.
3. Risiken für Beschuldigte
Für Beschuldigte birgt diese Praxis erhebliche Risiken:
Weitreichender Datenzugriff: Ermittler können auf Chats, Fotos, Kontakte und Standortdaten zugreifen.
Keine Umgehung durch Schweigen: Anders als bei der Herausgabe einer PIN schützt die Aussageverweigerung nicht vor dieser Maßnahme.
Mögliche Folgeverfahren: Gefundene Daten können auch neue Ermittlungsverfahren auslösen.
Grenzen des Datenschutzes: Auch wenn das Unionsrecht den Datenschutz stärkt, sieht der BGH hier keinen generellen Widerspruch zur EU-Grundrechtecharta.
Fazit
Mit diesem Urteil stärkt der BGH die Möglichkeiten der Strafverfolgung im digitalen Zeitalter. Für Beschuldigte bedeutet das: Wer in den Fokus von Ermittlungen gerät, kann sich nicht allein durch Schweigen oder Verweigerung der PIN-Eingabe vor einem Datenzugriff schützen. Umso wichtiger ist es, in einer solchen Situation sofort anwaltlichen Beistand einzuschalten, um Rechte zu wahren und unrechtmäßige Eingriffe zu verhindern.
Als spezialisierte Kanzlei im Bereich des Strafrechts stehen wir bereit, um Sie in allen Fragen rund um Ermittlungsmaßnahmen, Beweisverwertungsverbote und Verteidigungsstrategien zu unterstützen. Unsere Expertise reicht von der Beratung über die Prüfung der Rechtmäßigkeit polizeilicher Maßnahmen bis hin zur Vertretung in gerichtlichen Verfahren.
Wenn Sie Unterstützung benötigen oder weitere Fragen zu den Auswirkungen der BGH-Entscheidung haben, kontaktieren Sie uns gerne.
Wir stehen Ihnen an unseren Standorten in Sulingen, Bremen, Osnabrück oder online zur Verfügung.
FAQs
1. Darf die Polizei mein Handy mit meinem Fingerabdruck entsperren?
Ja, unter bestimmten Voraussetzungen und mit richterlicher Anordnung darf die Polizei den Finger eines Beschuldigten zwangsweise auflegen.
2. Gilt das auch ohne richterlichen Beschluss?
In der Regel ist eine richterliche Anordnung erforderlich. Ohne Beschluss ist die Maßnahme nur in Eilfällen zulässig.
3. Schützt mich das Recht zu schweigen vor der Maßnahme?
Nein, da es sich nicht um eine aktive Aussage handelt, sondern um das Dulden einer Zwangsmaßnahme.
4. Was passiert mit den gefundenen Daten?
Diese können gesichtet, beschlagnahmt und im Strafverfahren verwendet werden – selbst wenn die Rechtsgrundlage umstritten ist.
5. Kann ich mich dagegen wehren?
Ja, durch anwaltliche Hilfe kann geprüft werden, ob die Maßnahme rechtmäßig war und ggf. ein Beweisverwertungsverbot durchgesetzt werden.