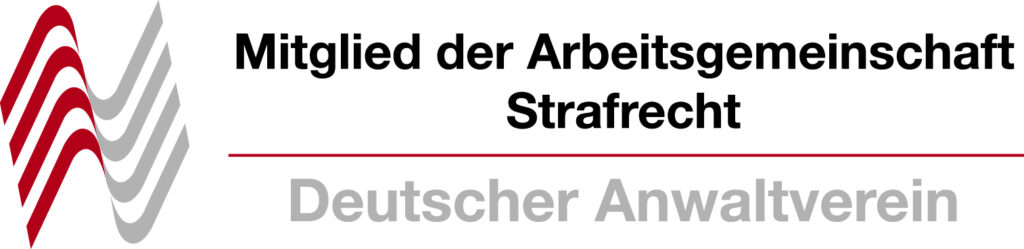Ob bei einer Körperverletzung nach einer Auseinandersetzung im Viertel oder bei einem gemeinschaftlich geplanten Betrug – es kommt im Alltag häufiger vor, dass nicht nur eine Person, sondern mehrere an der Begehung einer Straftat beteiligt sind. In solchen Fällen stellt sich für Strafverteidiger:innen in Bremen die zentrale Frage: Wer hat in welcher Form zur Tat beigetragen – und welche rechtlichen Konsequenzen ergeben sich daraus?
Das deutsche Strafrecht unterscheidet im Rahmen seines sogenannten dualistischen Beteiligungssystems zwischen Täter:innen und Teilnehmer:innen. Diese Unterscheidung ist essenziell, da sie unterschiedliche Strafbarkeitsvoraussetzungen und Konsequenzen mit sich bringt. Die relevanten Vorschriften finden sich in den §§ 25–27 des Strafgesetzbuchs (StGB).
In diesem Beitrag geben wir einen verständlichen Überblick über die verschiedenen Beteiligungsformen und erklären, warum die genaue Einordnung für Beschuldigte – etwa in einem Strafverfahren in Bremen – von großer Bedeutung ist.
1. Täter:in oder Teilnehmer:in – Woran erkennt man den Unterschied?
Nicht immer lässt sich auf den ersten Blick erkennen, ob jemand als Täter:in oder Teilnehmer:in einzuordnen ist. Gerade bei komplexeren Sachverhalten – etwa bei Gruppenstraftaten – ist die Abgrenzung entscheidend. Juristisch stehen sich zwei Theorien gegenüber:
- Die gemäßigte subjektive Theorie (vor allem von der Rechtsprechung genutzt): Entscheidend ist, ob die Beteiligten die Tat als eigene wollen oder nur das Verhalten anderer unterstützen.
- Die Tatherrschaftslehre (vor allem in der Literatur vertreten): Entscheidend ist, wer das Tatgeschehen in der Hand hat und lenkt – also „die Fäden zieht“.
In der Praxis nähern sich beide Ansätze an – oft führen sie zum gleichen Ergebnis. Dennoch bleibt die Frage der Täterschaft oder Teilnahme stets einzelfallabhängig.
Die verschiedenen Täterformen
1. Alleintäterschaft (§ 25 Abs. 1 Alt. 1 StGB)
Die klassische Form: Eine Person begeht die Tat allein und führt alle tatbestandlichen Handlungen selbst aus. Eine Beteiligung Dritter liegt nicht vor.
Beispiel aus der Praxis: Eine Einzelperson wird in Bremen beim Diebstahl in einem Geschäft erwischt – ohne dass andere involviert sind.
2. Mittelbare Täterschaft (§ 25 Abs. 1 Alt. 2 StGB)
Hier handelt eine Person nicht selbst, sondern lässt durch eine andere Person handeln – sie nutzt diese Person als „Werkzeug“. Diese Konstellation liegt oft vor, wenn der:die Ausführende schuldunfähig ist (z. B. bei Kindern oder psychisch Erkrankten) oder sich in einem relevanten Irrtum befindet. Die Person im Hintergrund – also der:die mittelbare Täter:in – wird dennoch so behandelt, als hätte sie selbst gehandelt.
Beispiel: Eine Person bringt ein Kind dazu, ein Paket mit Drogen zu übergeben, weil das Kind nicht weiß, was es transportiert.
3. Mittäterschaft (§ 25 Abs. 2 StGB)
Hier liegt eine gemeinsame Tatausführung vor. Zwei oder mehr Personen planen und begehen die Tat gemeinsam. Alle werden so behandelt, als hätten sie die gesamte Tat selbst ausgeführt – auch wenn sie arbeitsteilig vorgehen.
Voraussetzungen:
- Gemeinsamer Tatplan: Es muss eine klare Übereinkunft geben, gemeinsam eine bestimmte Tat zu begehen (ausdrücklich oder stillschweigend).
- Gemeinsame Tatausführung: Alle müssen einen relevanten Beitrag leisten.
Beispiel: Zwei Personen beschließen, gemeinsam eine Tankstelle in Bremen zu überfallen. Eine bedroht die Kassiererin, die andere nimmt das Geld an sich – beide haften als Mittäter:innen.
Die Teilnahmeformen: Anstiftung und Beihilfe
1. Anstiftung (§ 26 StGB)
Wer eine andere Person vorsätzlich zur Begehung einer vorsätzlichen und rechtswidrigen Tat bestimmt, wird als Anstifter:in bestraft. Das bedeutet: Der:die Haupttäter:in muss selbst vorsätzlich handeln – ob er:sie schuldhaft ist, spielt für die Strafbarkeit der Anstiftung keine Rolle.
Das „Bestimmen“ kann in vielerlei Form erfolgen – durch Überreden, Lügen, Versprechen oder auch durch nonverbale Kommunikation.
Wichtig: Die Person, die angestiftet wird, darf noch nicht zur Tat entschlossen gewesen sein. Andernfalls handelt es sich nicht um eine Anstiftung.
2. Beihilfe (§ 27 StGB)
Bei der Beihilfe wird eine andere Person bei ihrer Tat unterstützt. Dies kann auf zwei Arten erfolgen:
- Physisch, z. B. durch Bereitstellung von Tatwerkzeugen oder durch „Schmiere stehen“.
- Psychisch, z. B. durch moralische Unterstützung, technische Beratung oder „Mutmachen“.
Die Hilfeleistung muss vorsätzlich erfolgen – es reicht aber bereits der sogenannte Eventualvorsatz. Das bedeutet: Der:die Gehilfe:in hält die Möglichkeit der Haupttat für realistisch und nimmt dies in Kauf.
Auch heimliche Hilfe ist strafbar – der:die Täter:in muss also nicht wissen, dass er:sie Unterstützung erhält.
Warum diese Unterscheidung für Beschuldigte entscheidend ist
Ob jemand als Täter:in oder Teilnehmer:in eingeordnet wird, hat erhebliche Auswirkungen auf das Strafmaß und die Verteidigungsmöglichkeiten. Ein:e Mittäter:in haftet für die gesamte Tat – ein:e Gehilfe:in dagegen nur für den unterstützenden Beitrag. Im Strafverfahren kann diese Unterscheidung den Unterschied zwischen einer Freiheitsstrafe oder einer Einstellung des Verfahrens ausmachen.
Auch die Frage, ob ein:e Beschuldigte:r für das Handeln eines anderen haftet – z. B. im Fall eines sogenannten Mittäterexzesses – ist entscheidend. Weicht eine Person im Laufe der Tat vom Plan ab (z. B. durch spontane Gewalttätigkeit), haftet die andere Person unter Umständen nicht mehr mit.
Beispiel: Zwei Personen wollen gemeinsam eine Schlägerei provozieren. Einer der beiden zückt plötzlich ein Messer – dieser Gewaltakt war nicht geplant. Die andere Person haftet dann nicht wegen versuchten Totschlags, sondern ggf. nur wegen Körperverletzung.
Fazit: Nicht jede Beteiligung ist gleich strafbar
Ob eine Straftat alleine, gemeinsam oder unterstützend begangen wurde, ist im Strafrecht entscheidend. Gerade in Strafverfahren mit mehreren Beteiligten – etwa bei Gruppendelikten oder vermeintlich gemeinschaftlichen Handlungen – lohnt sich eine genaue rechtliche Prüfung der Beteiligungsform.
Als erfahrene Kanzlei für Strafrecht in Bremen unterstützen wir Sie kompetent bei der Einordnung Ihrer Rolle im Strafverfahren – sei es bei dem Vorwurf der Mittäterschaft, mittelbaren Täterschaft oder der Teilnahme. Nutzen Sie unsere Standorte in Bremen, Sulingen, Osnabrück oder unsere Online-Beratung. Wir stehen Ihnen mit Fachwissen, Erfahrung und Engagement zur Seite.
FAQ’s zum Thema Täterschaft und Teilnahme
1. Was ist der Unterschied zwischen Täterschaft und Teilnahme im Strafrecht?
Täter:innen begehen die Straftat selbst oder gemeinsam mit anderen. Teilnehmer:innen (Anstifter:innen oder Gehilf:innen) unterstützen nur eine fremde Tat.
2. Wann liegt Mittäterschaft vor?
Wenn mehrere Personen einen gemeinsamen Tatplan fassen und arbeitsteilig an der Tatausführung mitwirken. Alle Beteiligten haften wie Täter:innen.
3. Was versteht man unter mittelbarer Täterschaft?
Hier lässt eine Person die Tat durch eine andere ausführen, z. B. durch eine:n schuldunfähige:n oder getäuschte:n Dritte:n. Sie bleibt dennoch Täter:in.
4. Wie kann ich mich gegen den Vorwurf der Mittäterschaft verteidigen?
Indem geprüft wird, ob ein gemeinsamer Tatplan und ein relevanter Tatbeitrag vorlagen – und ob ggf. ein Exzess eines Mittäters vorliegt.
5. Ist man auch strafbar, wenn man nur „Schmiere gestanden“ hat?
Ja. Wer eine Straftat bewusst unterstützt – auch ohne selbst aktiv zu handeln – kann sich wegen Beihilfe nach § 27 StGB strafbar machen.