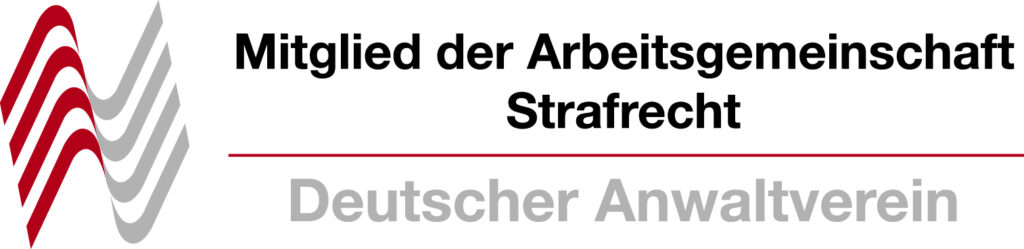Von einer sogenannten „Aussage-gegen-Aussage“-Konstellation spricht man im Strafverfahren immer dann, wenn der Tatvorwurf ausschließlich auf der Aussage einer einzelnen Person beruht – meist der:dem mutmaßlichen Geschädigten. Diese:r wirft dem:der Beschuldigten ein bestimmtes Verhalten vor, während diese:dieser entweder eine ganz andere Version der Ereignisse schildert oder die Tatvorwürfe schlicht bestreitet. Auch ein Schweigen des:der Angeklagten wird in diesem Zusammenhang juristisch wie ein Bestreiten gewertet – Schweigen darf im Strafrecht nicht negativ ausgelegt werden.
Solche Konstellationen treten insbesondere bei Sexualdelikten auf, bei denen oft keine neutralen Zeug:innen oder objektiven Beweismittel (wie etwa DNA-Spuren oder Verletzungen) zur Verfügung stehen. Das Gericht muss sich in solchen Fällen also allein auf die Aussagen der Beteiligten stützen – was die Beurteilung besonders anspruchsvoll macht.
In einer Stadt wie Bremen, wo persönliche Netzwerke und Bekanntschaften oft eng sind, kann es zusätzlich schwierig werden, die Unabhängigkeit von Zeug:innen zu beurteilen – vor allem, wenn diese aus dem unmittelbaren Umfeld der beteiligten Personen stammen, etwa Freund:innen, Partner:innen oder Verwandte.
1. Welche Rolle spielt „in dubio pro reo“?
Der Grundsatz „im Zweifel für den:die Angeklagte:n“ – juristisch als in dubio pro reo bezeichnet – bedeutet, dass bei nicht auszuräumenden Zweifeln zugunsten des:der Beschuldigten zu entscheiden ist. Wichtig ist aber: Eine „Aussage-gegen-Aussage“-Situation führt nicht automatisch zu einem Freispruch. Vielmehr prüft das Gericht genau, ob es sich von einer der Aussagen überzeugen lässt.
Der Maßstab ist dabei die sogenannte richterliche Überzeugung (§ 261 StPO). Das Gericht entscheidet also auf Basis seiner persönlichen Gewissheit, wie sich der Vorfall tatsächlich zugetragen hat. Kann das Gericht diese Überzeugung nicht gewinnen – zum Beispiel weil die Aussagen gleich glaubhaft oder gleich unglaubhaft sind – dann greift der Grundsatz in dubio pro reo.
Das bedeutet aber auch: Eine Verurteilung ist durchaus möglich, wenn das Gericht die Aussage der:des mutmaßlichen Geschädigten für glaubhaft hält und keinen Zweifel an deren Wahrheitsgehalt hat.
2. Wie trifft das Gericht seine Entscheidung?
Bei der Beurteilung der Glaubhaftigkeit von Aussagen orientiert sich das Gericht an einer Reihe von Kriterien, die unter anderem vom Bundesgerichtshof entwickelt wurden. Dazu zählen etwa:
• Konstanz im Kerngeschehen: Bleibt die Aussage über mehrere Vernehmungen hinweg stabil?
• Innere Logik und Nachvollziehbarkeit: Ist der geschilderte Ablauf in sich schlüssig?
• Detailtiefe, insbesondere bei nebensächlichen oder ungewöhnlichen Aspekten
• Schilderung von Kommunikation und Interaktion: Wird beschrieben, wie gesprochen oder reagiert wurde?
• Persönliche Wahrnehmung: Werden Emotionen, Gedanken oder körperliche Reaktionen geschildert?
Zusätzlich berücksichtigt das Gericht auch:
• Mögliche Falschbelastungsmotive, z. B. aus Eifersucht, Streit oder Rache
• Einflüsse Dritter: Wurde die Aussage durch andere beeinflusst oder nachträglich verändert?
• Aussagefähigkeit: Besonders bei jungen oder psychisch auffälligen Zeug:innen wird geprüft, ob diese überhaupt in der Lage sind, das Erlebte zuverlässig wiederzugeben.
In der Praxis – auch hier bei uns in Bremen – kann in solchen Fällen ein psychologisches Glaubhaftigkeitsgutachten eine entscheidende Rolle spielen. Dieses wird häufig von der Verteidigung beantragt, wenn Zweifel an der Aussagekraft oder der psychischen Verfassung eines:einer Zeug:in bestehen.
Fazit
Gerade in „Aussage-gegen-Aussage“-Konstellationen ist eine kompetente strafrechtliche Verteidigung unerlässlich. Denn das Gericht entscheidet auf Basis der subjektiven Überzeugung – und diese kann durch eine gezielte Beweisanregung oder eine professionelle Aussageanalyse maßgeblich beeinflusst werden.
FAQ’s zum Them Aussage gegen Aussage
1. Führt eine Aussage-gegen-Aussage-Situation automatisch zum Freispruch?
Nein. Auch wenn keine weiteren Beweise vorliegen, kann das Gericht eine Verurteilung aussprechen – sofern es der Aussage einer Person glaubt.
2. Welche Rolle spielt „in dubio pro reo“ bei Aussage-gegen-Aussage?
Der Grundsatz greift nur, wenn das Gericht nach der Beweiswürdigung nicht von der Schuld überzeugt ist. Er ist keine Beweis-, sondern eine Entscheidungsregel.
3. Wann sollte man ein Glaubhaftigkeitsgutachten beantragen?
Wenn Zweifel an der Aussagekraft, Wahrnehmungsfähigkeit oder Unabhängigkeit eines:einer Zeug:in bestehen, kann ein solches Gutachten entscheidend sein.