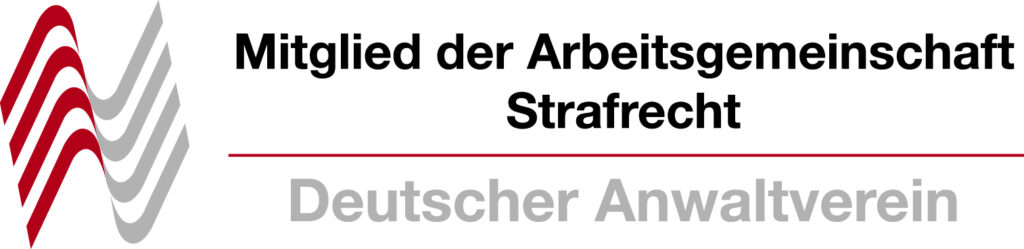Am Ende eines strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens liegt es bei der Staatsanwaltschaft, zu entscheiden, wie das Verfahren weitergeführt wird. Dabei geht es vor allem um die Frage: Wird Anklage erhoben oder nicht?
Eine Möglichkeit ist die Einstellung des Verfahrens mangels hinreichenden Tatverdachts nach § 170 Abs. 2 StPO. Doch daneben sieht die Strafprozessordnung noch weitere Formen der Verfahrenseinstellung vor – insbesondere solche, die mit Auflagen und Weisungen verbunden sein können.
Für Beschuldigte ist vor allem die Einstellung nach § 153a StPO von Bedeutung. Hierbei kann das Verfahren – etwa gegen Zahlung einer Geldauflage – vorläufig eingestellt werden, ohne dass es zu einer öffentlichen Hauptverhandlung kommt. Diese Form der Einigung wird häufig auf Anregung der Verteidigung in Betracht gezogen und bietet eine Möglichkeit, das Verfahren ohne Schuldfeststellung zu beenden.
Welche Option im konkreten Fall sinnvoll ist, hängt von zahlreichen Faktoren ab und sollte durch die Verteidigung aktiv in die Diskussion mit der Staatsanwaltschaft eingebracht werden.
1. Was bedeutet „Einstellung“ im Strafverfahren?
Zunächst: Nicht jede Einstellung ist gleich. Es kommt darauf an, aus welchem Grund das Verfahren beendet wird:
- § 170 Abs. 2 StPO – Einstellung mangels Tatverdachts
Wenn sich nach den Ermittlungen herausstellt, dass entweder keine Straftat vorliegt oder diese nicht nachweisbar ist, wird das Verfahren eingestellt. Für Beschuldigte bedeutet das: Die Sache ist (nahezu) erledigt. - § 153 StPO – Einstellung wegen Geringfügigkeit
In Fällen von geringfügigen Verstößen kann das Verfahren ebenfalls beendet werden, ohne dass es zu einer Bestrafung kommt – vorausgesetzt, es besteht kein öffentliches Interesse an der Strafverfolgung. Auch hier bleibt es für Beschuldigte folgenlos. - Strafbefehl oder Anklage
Ist die Staatsanwaltschaft hingegen der Meinung, dass eine Bestrafung erforderlich ist, stellt sie entweder einen Strafbefehlsantrag oder erhebt Anklage. Dann landet die Sache vor Gericht – mit allen Konsequenzen.
2. Dazwischen: Die Einstellung gegen Auflage nach § 153a StPO
Die Einstellung gegen Auflagen und Weisungen ist ein Mittelweg. Sie wird oft in Fällen gewählt, in denen der Tatnachweis zwar wahrscheinlich erscheint, aber das öffentliche Interesse an einer strafrechtlichen Verurteilung nicht überwiegt. In der Praxis ist diese Form der Verfahrensbeendigung weit verbreitet – auch hier in Bremen.
Zentrale Bedingung für diese Art der Einstellung ist: Der:die Beschuldigte muss zustimmen. Ohne ihre Einwilligung kann die Staatsanwaltschaft die Einstellung nicht durchführen. In der Regel beinhaltet der Vorschlag die Zahlung eines Geldbetrags – entweder an die Landeskasse oder an eine gemeinnützige Organisation wie die Bremer Krebshilfe oder andere lokale Initiativen.
3. Warum viele das Schreiben der Staatsanwaltschaft missverstehen
In vielen Fällen kommt das Schreiben völlig unerwartet. Wer keine:n Verteidiger:in hat, versteht das Schreiben häufig als eine Art Rechnung oder Bußgeldbescheid – aber das ist ein Irrtum. Es handelt sich vielmehr um ein „Angebot“, das Verfahren ohne Strafe zu beenden. Und dieses Angebot darf man auch ablehnen – mit möglichen Folgen.
4. Welche Konsequenzen hat eine Zustimmung?
Zunächst die gute Nachricht: Eine Einstellung nach § 153a StPO wird nicht im Bundeszentralregister eingetragen – sie taucht also nicht im Führungszeugnis auf. Rechtlich gesehen gilt man weiterhin als unschuldig, denn ein Schuldspruch erfolgt nicht. Dennoch kann es in bestimmten Bereichen zu Konsequenzen kommen:
- Im Beamtenrecht sind disziplinarrechtliche Schritte trotz Einstellung möglich
- Im Zivilrecht kann die Zustimmung zur Einstellung als Eingeständnis gewertet werden
Besonders problematisch wird das etwa bei Verfahren wegen Fahrerflucht: Stimmen Sie hier einer Einstellung zu, kann Ihre Kfz-Haftpflichtversicherung später Regress verlangen.
5. Was tun, wenn die Geldauflage zu hoch ist?
Die Höhe der Geldauflage orientiert sich grob an dem, was im Falle einer Verurteilung als Geldstrafe verhängt worden wäre – nur meist etwas darunter. In Bremen sind bei einfachen Delikten (z. B. Beleidigung oder Hausfriedensbruch) Geldauflagen zwischen 300 und 800 Euro nicht unüblich.
Wenn Sie wirtschaftlich nicht in der Lage sind, diesen Betrag zu zahlen, können Sie einen Gegenvorschlag machen. Wichtig ist, Ihre finanziellen Verhältnisse nachvollziehbar darzulegen – also etwa durch eine Übersicht Ihrer monatlichen Einnahmen und Ausgaben. Auch eine längere Zahlungsfrist kann beantragt werden, allerdings beträgt die maximale Frist in der Regel sechs Monate. Ratenzahlungen über mehrere Jahre sind also nicht möglich.
Beachten Sie: Einen Rechtsanspruch auf eine niedrigere Geldauflage haben Sie nicht. Wenn Sie das Angebot ablehnen oder der Gegenvorschlag nicht angenommen wird, kann es sein, dass stattdessen ein Strafbefehl beantragt wird.
6. Was passiert, wenn Sie nicht zustimmen?
Lehnen Sie das Angebot ab oder reagieren nicht, wird das Verfahren in der Regel fortgesetzt. Die Staatsanwaltschaft beantragt dann einen Strafbefehl – das ist eine gerichtliche Entscheidung über eine Geldstrafe, ohne dass eine Hauptverhandlung stattfindet.
Gegen einen Strafbefehl können Sie Einspruch einlegen, doch dann kommt es meist zu einer Hauptverhandlung vor dem Strafgericht. Einmal abgelehnt, ist eine spätere Einstellung nach § 153a StPO oft schwieriger zu erreichen. Viele Staatsanwält:innen sehen das als „verpasste Gelegenheit“ und bestehen dann auf einer gerichtlichen Entscheidung.
Fazit: Was ist zu tun?
Das Angebot der Einstellung gegen Geldauflage kann ein sinnvoller Ausweg sein – insbesondere wenn eine Einstellung mangels Tatnachweis unrealistisch erscheint. Gleichzeitig sollte man eine Zustimmung gut überlegen, insbesondere bei Vorwürfen wie Unfallflucht oder Körperverletzung, wo zivilrechtliche Folgen drohen.
Unser Rat: Lassen Sie sich anwaltlich beraten, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Gerade in Bremen gibt es viele Möglichkeiten, die individuellen Umstände Ihres Falls sachgerecht zu würdigen. Wir unterstützen Sie gerne – persönlich, vertraulich und mit dem nötigen juristischen Feingefühl.
FAQs zum Thema „Einstellung gegen Geldauflage“
1. Was bedeutet eine Einstellung nach § 153a StPO?
Das Verfahren wird gegen Auflagen – meist eine Geldzahlung – eingestellt. Es kommt nicht zu einer Verurteilung, und es erfolgt kein Eintrag im Führungszeugnis.
2. Muss ich der Einstellung zustimmen?
Ja. Ohne Ihre Zustimmung kann die Staatsanwaltschaft das Verfahren nicht nach § 153a StPO beenden.
3. Ist die Zahlung einer Geldauflage eine Art Schuldeingeständnis?
Juristisch nein – Sie gelten weiterhin als unschuldig. In bestimmten Fällen (z. B. gegenüber Versicherungen) kann die Zustimmung aber als Indiz gewertet werden.
4. Kann ich die Höhe der Geldauflage verhandeln?
Ein Anspruch besteht nicht, aber Sie können Gegenvorschläge machen und Ihre finanziellen Verhältnisse offenlegen.