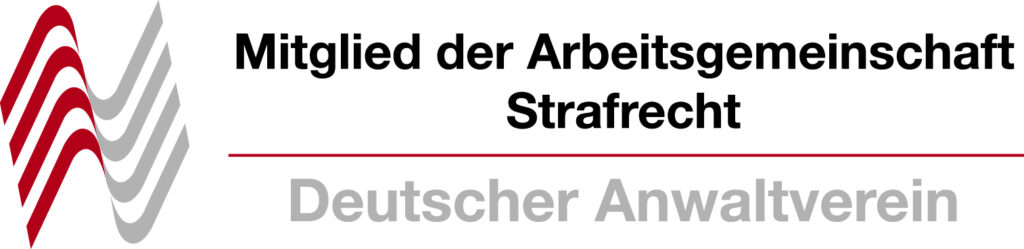Facebook, Instagram, TikTok, YouTube und Co. – soziale Medien sind längst fester Bestandteil unseres Alltags geworden. Insbesondere für junge Menschen – die sogenannten „Digital Natives“ – ist es völlig normal, rund um die Uhr online zu sein: posten, liken, kommentieren und teilen gehört zum täglichen Leben. Während die Nutzung digitaler Plattformen für viele eine Bereicherung darstellt, geraten rechtliche Risiken dabei häufig aus dem Blickfeld.
Gerade aus rechtlicher Sicht ist bemerkenswert, wie sich der Umgang mit persönlichen Daten und Bildern in den letzten Jahrzehnten verändert hat. Noch 1983 formulierte das Bundesverfassungsgericht im legendären Volkszählungsurteil das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung – ein Grundsatz, der heute aktueller ist denn je. Dennoch ist im Jahr 2025 der Umgang mit privaten Daten oft sorglos: Selfies, Storys, Screenshots – und das nicht nur von sich selbst, sondern häufig auch von anderen Personen – werden ohne große Bedenken geteilt. Doch genau hier setzt das Internetstrafrecht an: Wo persönliche Freiheit endet und rechtliche Grenzen überschritten werden, können strafbare Handlungen vorliegen.
Insbesondere in einer Großstadt wie Bremen, die für ihren offenen und vernetzten Lebensstil bekannt ist, kommt es immer wieder zu Fällen von Cybermobbing, Beleidigungen, Datenmissbrauch oder dem unerlaubten Teilen von Bildern. Das Internet ist eben kein rechtsfreier Raum – auch wenn viele Nutzer:innen dies noch immer zu glauben scheinen.
1. Beleidigung im Netz (§ 185 StGB): Was offline verboten ist, ist online nicht erlaubt
Hasskommentare, respektlose Äußerungen und digitale Hetze: Soziale Netzwerke wie Facebook oder X (ehemals Twitter) bieten eine Bühne, auf der sich manche Nutzer:innen zu besonders ausfälligem Verhalten hinreißen lassen. Die vermeintliche Anonymität des Internets senkt die Hemmschwelle – doch auch online gilt: Wer beleidigt, macht sich strafbar.
Der Tatbestand der Beleidigung (§ 185 StGB) schützt die persönliche Ehre. Dabei kann bereits ein kurzer Kommentar unter einem Beitrag den Straftatbestand erfüllen – es muss sich nicht immer um drastische Schimpfwörter handeln. Auch vergleichsweise milde Bezeichnungen können strafbar sein, wenn sie die Würde der betroffenen Person verletzen. Das gilt selbstverständlich auch für Formulierungen in E-Mails, WhatsApp-Nachrichten oder Online-Bewertungen. Das Strafmaß reicht von einer Geldstrafe bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe – und bei öffentlicher Beleidigung sogar darüber hinaus.
2. Üble Nachrede und Verleumdung (§§ 186, 187 StGB): Wenn Gerüchte zur Straftat werden
Ein typisches Beispiel aus dem Arbeitsalltag in Bremen: In einer WhatsApp-Gruppe behauptet ein:e Kolleg:in, ein anderer Kollege sei faul und komme regelmäßig zu spät. Klingt harmlos? Ist es nicht unbedingt. Solche Aussagen können schnell als üble Nachrede (§ 186 StGB) eingestuft werden – vor allem dann, wenn sie gegenüber Dritten geäußert werden und dem Ruf des Betroffenen schaden.
Geht die Äußerung sogar noch einen Schritt weiter – und der:die Verfasser:in weiß, dass die Behauptung falsch ist –, dann liegt eine Verleumdung (§ 187 StGB) vor. Beide Delikte zählen zu den sogenannten Ehrdelikten. Das Strafmaß hängt dabei von der Schwere und der Art der Verbreitung ab: Wird die Aussage öffentlich, z. B. über soziale Netzwerke oder Messenger, verbreitet, drohen empfindlichere Strafen.
Wichtig zu wissen: Diese Delikte sind sogenannte Antragsdelikte, d.h. die betroffene Person muss innerhalb von drei Monaten aktiv einen Strafantrag stellen – sonst bleibt der Rechtsverstoß straflos.
3. Das Recht am eigenen Bild (§§ 22, 23 KunstUrhG): Ohne Zustimmung wird’s heikel
Was in der Bremer Innenstadt oft nur ein schneller Schnappschuss mit dem Smartphone ist, kann rechtlich problematisch sein: Das Recht am eigenen Bild schützt jede:n davor, dass Fotos oder Videos ohne Einwilligung veröffentlicht oder weitergeleitet werden. Ob bei öffentlichen Veranstaltungen, im Straßenverkehr oder am Arbeitsplatz – wer andere Personen abbildet und das Material online teilt, sollte sich der rechtlichen Grenzen bewusst sein.
Nur in Ausnahmefällen – etwa bei Bildnissen der Zeitgeschichte oder bei Aufnahmen, auf denen Personen lediglich „Beiwerk“ sind – ist eine Veröffentlichung auch ohne Zustimmung erlaubt. Ansonsten gilt: Die Zustimmung der abgebildeten Person ist erforderlich. Verstoßen Nutzer:innen gegen diese Regel, droht eine Geld- oder Freiheitsstrafe (§ 33 KunstUrhG).
4. § 201a StGB: Schutz der Intimsphäre vor heimlichen Aufnahmen
Noch gravierender wird es, wenn Fotos oder Videos in besonders sensiblen Situationen gemacht und geteilt werden. Der Straftatbestand der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen (§ 201a StGB) umfasst unter anderem heimlich aufgenommene oder bloßstellende Inhalte – etwa von Betrunkenen, Verletzten oder sogar Nacktbilder, die ohne Zustimmung verbreitet werden („Revenge Porn“).
In Bremen kam es in den vergangenen Jahren immer wieder zu Ermittlungen wegen genau solcher Fälle – meist mit jungen Täter:innen und Opfern. Auch wenn Betroffene zunächst Hemmungen haben, rechtliche Schritte einzuleiten: Die rechtlichen Möglichkeiten bestehen – und die Strafverfolgungsbehörden nehmen solche Vorfälle zunehmend ernst.
Fazit: Internetstrafrecht ist mehr als ein Randthema
Ob Beleidigungen in Kommentarspalten, Rufschädigung in Gruppen-Chats oder heimliche Videoaufnahmen – das Internet hat die Spielregeln verändert, aber die Gesetze gelten auch dort. Gerade in einer vernetzten Stadt wie Bremen zeigt sich, wie wichtig rechtliche Aufklärung und konsequente Strafverfolgung im digitalen Raum sind.
Das Internetstrafrecht ist kein Nischenthema, sondern ein hochaktuelles Feld mit vielfältigen Bezügen zu unserem Alltag. Wenn Sie das Gefühl haben, im Netz ungerecht behandelt oder sogar strafrechtlich relevant angegriffen worden zu sein – oder selbst mit dem Vorwurf einer Straftat konfrontiert werden – ist eine frühzeitige rechtliche Beratung unerlässlich.
Als erfahrene Kanzlei im Bereich des Strafrechts – auch mit besonderem Augenmerk auf Internetstrafrecht – unterstützen wir Sie kompetent und vertraulich bei allen rechtlichen Fragen rund um Online-Delikte. Wir stehen Ihnen an unseren Standorten in Sulingen, Bremen, Osnabrück oder auch Online zur Verfügung.
FAQ’s zum Thema Internetstrafrecht
1. Was versteht man unter Internetstrafrecht?
Das Internetstrafrecht umfasst alle strafbaren Handlungen, die online begangen werden – von Beleidigung über Urheberrechtsverstöße bis hin zu Cybermobbing.
2. Was tun, wenn ich im Internet beleidigt wurde?
Sichern Sie Beweise (z. B. Screenshots) und stellen Sie möglichst schnell einen Strafantrag – am besten nach vorheriger anwaltlicher Beratung.
3. Ist das Teilen eines fremden Fotos ohne Erlaubnis strafbar?
Ja. Ohne Einwilligung der abgebildeten Person kann das eine Straftat nach dem Kunsturhebergesetz oder § 201a StGB darstellen.
4. Gilt das Strafrecht auch in WhatsApp-Gruppen oder privaten Nachrichten?
Ja. Auch dort können strafbare Beleidigungen, Verleumdungen oder Bildverstöße vorkommen – das Internet ist kein rechtsfreier Raum.
5. Wie lange habe ich Zeit, um Anzeige zu erstatten?
Bei den meisten Internetdelikten (z. B. Beleidigung) haben Betroffene 3 Monate Zeit, um Strafantrag zu stellen (§ 77b StGB).