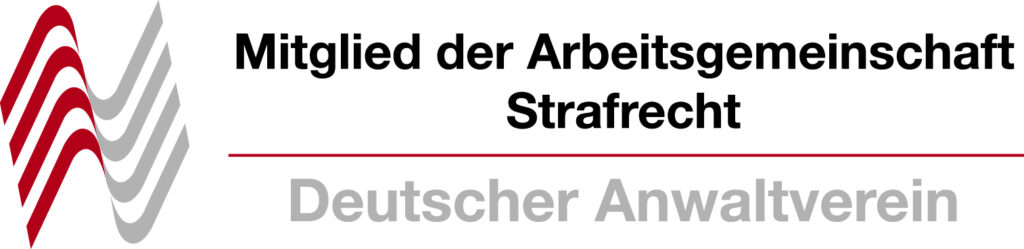Wurden Straftäter:innen zu einer Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt, bedeutet das keineswegs, dass sie „frei“ im klassischen Sinne sind. Es handelt sich vielmehr um eine Art letzte Chance – die jedoch an strenge Bedingungen geknüpft ist. Wer gegen diese Vorgaben verstößt, muss damit rechnen, dass die Bewährung widerrufen wird und die Freiheitsstrafe tatsächlich vollstreckt wird.
Gerade in Bremen und Umgebung – etwa bei wiederholten Verstößen im Zusammenhang mit Drogen, Diebstahl oder Körperverletzungsdelikten – beobachten wir regelmäßig, dass Betroffene die Gefahren eines Widerrufs unterschätzen. In diesem Beitrag erklären wir verständlich, welche Regeln während der Bewährungszeit gelten, was genau zum Widerruf führen kann und wie man sich im Ernstfall am besten verhält.
1. Was bedeutet „Bewährung“ eigentlich?
Im Volksmund gilt Bewährung oft als „zweite Chance“. Das trifft den Kern zwar grob, greift aber zu kurz. Juristisch bedeutet Bewährung, dass die Vollstreckung einer Freiheitsstrafe ausgesetzt wird – unter der Voraussetzung, dass sich die verurteilten Personen in einer festgelegten Zeit straffrei verhalten und bestimmte Auflagen oder Weisungen erfüllen.
Im Bewährungsbeschluss legt das Gericht unter anderem fest:
- die Dauer der Bewährungszeit (in der Regel zwischen zwei und fünf Jahren),
- Auflagen wie Geldzahlungen oder Schadenswiedergutmachung,
- Weisungen zur Lebensführung (z. B. Aufenthaltsvorgaben, Meldepflichten, Kontaktverbote).
Diese Regelungen dienen nicht nur der Resozialisierung, sondern sollen sicherstellen, dass keine weiteren Straftaten begangen werden.
2. Auflagen vs. Weisungen – wo liegt der Unterschied?
Bewährungsauflagen nach § 56b StGB sind in der Regel tatbezogene Bedingungen. Sie sollen sicherstellen, dass Täter:innen Verantwortung übernehmen und für das angerichtete Unrecht einstehen. Dazu gehören etwa:
- Wiedergutmachung des Schadens,
- Zahlung eines Geldbetrags an die Staatskasse oder eine gemeinnützige Einrichtung,
- Ableistung gemeinnütziger Arbeit.
Weisungen gemäß § 56c StGB betreffen dagegen die persönliche Lebensführung. Sie werden ausgesprochen, wenn das Gericht glaubt, dass durch gezielte Vorgaben Rückfälle vermieden werden können. Mögliche Weisungen sind:
- bestimmte Aufenthaltsorte oder Meldepflichten,
- Therapieauflagen oder Entziehungskuren,
- Kontaktverbote zu bestimmten Personen,
- Verpflichtung zur regelmäßigen Arbeitssuche oder Schulbesuch.
Die Nichtbeachtung dieser Vorgaben kann schwerwiegende Folgen haben – bis hin zum Widerruf der Bewährung.
3. Wann kommt ein:e Bewährungshelfer:in ins Spiel?
Ein:e Bewährungshelfer:in wird laut § 56d StGB vor allem dann eingesetzt, wenn:
- die Freiheitsstrafe mehr als neun Monate beträgt,
- die verurteilte Person unter 27 Jahre alt ist,
- und das Gericht eine intensive Betreuung für sinnvoll hält.
Der oder die Bewährungshelfer:in hat eine doppelte Rolle: Einerseits soll er:sie beratend und unterstützend tätig sein, andererseits aber auch die Einhaltung der gerichtlichen Vorgaben überwachen und regelmäßig Bericht erstatten.
4. Wann droht der Widerruf der Bewährung?
Der gesetzliche Rahmen für einen Widerruf ist in § 56f StGB geregelt. Demnach kann die Bewährung widerrufen werden, wenn:
- in der Bewährungszeit eine neue Straftat begangen wird,
- Auflagen oder Weisungen gröblich und beharrlich missachtet werden,
- der Kontakt zum Bewährungshelfer verweigert wird.
Wichtig: Nicht jeder Verstoß führt automatisch zum Widerruf. Gerade bei leichteren oder fahrlässigen Delikten prüfen Gerichte, ob die neue Straftat wirklich zeigt, dass die Resozialisierung gescheitert ist. Ebenso wird bei Auflagenverstößen geschaut, ob der Verstoß aus eigenem Verschulden entstanden ist – etwa bei nicht gezahlten Geldauflagen aufgrund tatsächlicher Mittellosigkeit.
Doch auch das Gegenteil ist der Fall: Selbst ohne Verurteilung – etwa bei einem glaubhaften Geständnis – kann ein Widerruf in Betracht gezogen werden. Insbesondere in Bremen haben wir mehrfach erlebt, dass Verfahren wegen kleinerer Delikte wie Schwarzfahren oder Bagatelldiebstahl dennoch zu einem Bewährungswiderruf geführt haben, wenn es bereits vorher Probleme mit der Einhaltung der Auflagen gab.
5. Wie läuft das Widerrufsverfahren ab?
Die Entscheidung über den Widerruf trifft das Gericht im Rahmen eines schriftlichen Beschlussverfahrens nach § 453 StPO. Die Staatsanwaltschaft und die beschuldigte Person werden vorab angehört – meistens schriftlich. Eine mündliche Anhörung ist nur vorgesehen, wenn der Widerruf auf Verstößen gegen Auflagen oder Weisungen beruht.
Spätestens zu diesem Zeitpunkt sollten Beschuldigte eine:n erfahrene:n Strafverteidiger:in einschalten. Denn das Verfahren kann zur Vollstreckung der ursprünglich verhängten Freiheitsstrafe führen. Gerade im Hinblick auf eine „zweite oder dritte Chance“ ist es entscheidend, entlastende Argumente professionell vorzubringen.
Wird die Bewährung widerrufen, kann gegen den Beschluss binnen einer Woche Beschwerde eingelegt werden. Diese Frist ist zwingend zu beachten.
Fazit: Bei drohendem Bewährungswiderruf sofort handeln
Wer während der Bewährungszeit gegen gerichtliche Vorgaben verstößt, riskiert nicht nur eine erneute Strafverfolgung, sondern auch die Vollstreckung der Freiheitsstrafe. Gerade in Bremen, wo viele Verfahren aufgrund erneuter Delikte oder Auflagenverstöße geführt werden, ist schnelles Handeln gefragt. Lassen Sie sich rechtzeitig beraten – denn oft lässt sich der Widerruf mit der richtigen Strategie noch abwenden.
Als erfahrene Kanzlei für Strafrecht stehen wir Ihnen in Bremen, Sulingen, Osnabrück oder auch Online zur Seite. Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Fragen zum Thema Bewährungswiderruf haben oder eine kompetente Verteidigung benötigen.
FAQ’s zum Thema Widerruf der Bewährung
1. Was passiert, wenn ich während der Bewährung eine neue Straftat begehe? In der Regel wird dann geprüft, ob die neue Tat zeigt, dass die frühere Verurteilung keine Wirkung hatte. Ein Widerruf ist dann möglich – aber nicht automatisch.
2. Kann ich gegen einen Bewährungswiderruf etwas unternehmen?
Ja. Gegen den gerichtlichen Beschluss kann binnen einer Woche Beschwerde eingelegt werden. Eine gute Strafverteidigung ist hier entscheidend.
3. Welche Rolle spielt der Bewährungshelfer beim Widerruf?
Er oder sie berichtet dem Gericht über Ihre Entwicklung. Bei Kontaktverweigerung oder Missachtung seiner Aufsichtspflichten kann das den Widerruf begünstigen.
4. Gilt ein Verstoß gegen Auflagen immer als Widerrufsgrund?
Nein, nur bei beharrlichen oder groben Verstößen – und wenn daraus eine schlechte Kriminalprognose entsteht.
5. Was kann ich tun, wenn ich eine Geldauflage nicht zahlen kann?
Wichtig ist, frühzeitig mit dem Gericht oder dem Bewährungshelfer Kontakt aufzunehmen. Eine Ratenzahlung oder Umwandlung in Sozialstunden ist oft möglich.