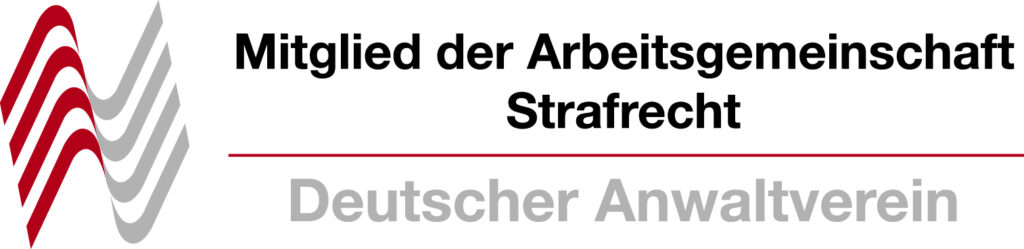Jugendliche Täter:in – das klingt für viele erstmal dramatisch. Doch wer sich an die eigene Jugend erinnert, weiß: Diese Lebensphase ist geprägt von Emotionen, Selbstfindung und dem Austesten von Grenzen. Egal ob bei den ersten Partys, kleinen Mutproben oder hitzigen Auseinandersetzungen – viele junge Menschen geraten früher oder später mit den Regeln der Gesellschaft in Konflikt. Nicht selten endet das mit einem Verstoß gegen das Strafrecht.
Dass es dabei nicht immer um kriminelle Energie geht, sondern oft um Unerfahrenheit, Gruppenzwang oder schlicht jugendliche Unbedachtheit, spiegelt sich auch in der Gesetzgebung wider: Genau dafür gibt es das Jugendgerichtsgesetz (JGG) – ein eigenes Strafrechtssystem für junge Menschen zwischen 14 und 21 Jahren.
Gerade in einer Großstadt wie Bremen, wo viele Jugendliche aus unterschiedlichen sozialen Milieus zusammenkommen, zeigt sich die Bedeutung eines verständnisvollen, aber konsequenten Jugendstrafrechts besonders deutlich.
1. Warum braucht es ein eigenes Jugendstrafrecht?
Während das Erwachsenenstrafrecht auf Schuldausgleich, Sühne und Abschreckung setzt, verfolgt das Jugendstrafrecht einen anderen Ansatz: Erziehung statt Bestrafung. Es geht darum, junge Menschen wieder auf den richtigen Weg zu bringen – bevor sie langfristig in kriminelle Strukturen abrutschen.
Nach § 2 JGG steht der Erziehungsgedanke im Mittelpunkt: Das Ziel ist, weitere Straftaten zu verhindern, indem man individuell auf die Lebenssituation und das soziale Umfeld der jugendlichen Person eingeht. Das gilt nicht nur für Jugendliche zwischen 14 und 18, sondern unter bestimmten Umständen auch für Heranwachsende zwischen 18 und 21 Jahren.
2. Wer fällt unter das Jugendstrafrecht?
Laut § 1 JGG gilt das Gesetz für zwei Gruppen:
- Jugendliche (14 – 17 Jahre)
- Heranwachsende (18 – 20 Jahre), bei denen das Gericht prüft, ob sie in ihrer Reife noch einem Jugendlichen gleichzusetzen sind.
Für Kinder unter 14 Jahren gilt das Jugendstrafrecht nicht. Kommt es hier zu Straftaten, schaltet sich in der Regel das Jugendamt ein und ergreift erzieherische Maßnahmen.
Ein spannender Punkt: Entscheidend ist immer das Alter zum Zeitpunkt der Tat, nicht zum Zeitpunkt des Verfahrens. Hat also jemand mit 17 eine Straftat begangen, wird auch dann noch das Jugendstrafrecht angewendet, wenn die Person mittlerweile volljährig ist.
3. Wie läuft ein Jugendstrafverfahren ab?
Das Verfahren ist deutlich weniger formell und mehr auf Begleitung ausgelegt als bei Erwachsenen. Es soll schnell gehen, individuell abgestimmt sein – und möglichst ohne Gerichtsprozess enden:
Staatsanwaltschaft und Gericht können das Verfahren einstellen, z. B. wenn bereits Maßnahmen durch das Jugendamt eingeleitet wurden (§ 45, § 47 JGG).
- Die Jugendgerichtshilfe ist immer beteiligt und stellt dem Gericht Informationen zur Persönlichkeit, familiären Situation und sozialen Lage zur Verfügung
- Die Verhandlung selbst ist nicht öffentlich (§ 48 JGG), um die Privatsphäre des:der Jugendlichen zu schützen
Besonders in Städten wie Bremen, wo Jugendkriminalität und soziale Brennpunkte lokal konzentriert auftreten, ist die enge Zusammenarbeit von Schulen, Jugendamt und Justiz essenziell.
4. Welche Sanktionen sieht das Jugendstrafrecht vor?
Das JGG unterscheidet zwischen:
a) Erziehungsmaßregeln (§§ 9 ff. JGG)
Zum Beispiel:
- Teilnahme an einem sozialen Trainingskurs
- Annahme einer Ausbildung
- Betreuung durch einen Erziehungsbeistand
Diese Maßnahmen sollen präventiv und unterstützend wirken, oft in enger Zusammenarbeit mit dem Jugendamt.
b) Zuchtmittel (§§ 13 ff. JGG)
Zuchtmittel sind spürbare, aber noch keine Freiheitsentziehung:
- Verwarnung
- Auflagen, z. B. Schadenswiedergutmachung oder soziale Arbeit
- Jugendarrest: Kurzarrest (2 Tage), Freizeitarrest (an Wochenenden) oder Dauerarrest (bis 4 Wochen)
Ziel: Ein „Warnschuss“, ohne langfristige Konsequenzen für Schule oder Ausbildung.
c) Jugendstrafe (§§ 17 ff. JGG)
Die letzte Stufe – vergleichbar mit der Freiheitsstrafe im Erwachsenenrecht. Sie wird nur verhängt, wenn:
- Andere Maßnahmen nicht ausreichen, um die Entwicklung positiv zu beeinflussen
- Die Schuld besonders schwer wiegt (z. B. bei Gewaltverbrechen)
Die Strafe kann zur Bewährung ausgesetzt werden – auch das ist im Sinne des Erziehungsgedankens.
5. Rechtsmittel und Verfahren in der Praxis
Damit der erzieherische Effekt nicht durch zu lange Verfahren verpufft, sind die Rechtsmittel eingeschränkt (§ 55 JGG). Es gibt nur ein Rechtsmittel – entweder Berufung oder Revision. Damit sollen Verfahren schnell abgeschlossen und die Sanktionen noch als unmittelbare Reaktion auf die Tat wahrgenommen werden.
Fazit: Warum dasJugendstrafrecht mehr als nur „milde“ ist
Das Jugendstrafrecht ist kein Kuschelkurs, sondern ein durchdachtes System, das konsequent, aber erzieherisch reagiert. Gerade in urbanen Regionen wie Bremen, wo Jugendliche durch soziale Umstände oft besonders herausgefordert sind, ist das Zusammenspiel von Justiz, Schule und Jugendhilfe entscheidend für eine erfolgreiche Resozialisierung.
Wenn Sie rechtliche Unterstützung im Jugendstrafrecht benötigen – sei es als betroffene:r Jugendliche:r oder als Elternteil – stehen wir Ihnen gerne mit unserer Expertise zur Seite. Vereinbaren Sie einfach einen Termin an unseren Standorten in Bremen, Sulingen, Osnabrück oder Online.
FAQ’s zum Thema Jugendstrafrecht
1. Wann gilt das Jugendstrafrecht in Bremen?
Das Jugendstrafrecht gilt für Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren sowie unter bestimmten Bedingungen für Heranwachsende bis 21 Jahre – auch in Bremen.
2. Welche Strafen drohen Jugendlichen bei Straftaten?
Von erzieherischen Maßnahmen über Jugendarrest bis hin zur Jugendstrafe – je nach Tat und Reifegrad drohen unterschiedliche Sanktionen.
3. Wird das Verfahren gegen Jugendliche öffentlich geführt?
Nein. Die Hauptverhandlung im Jugendstrafverfahren ist grundsätzlich nicht öffentlich, um den Schutz der Jugendlichen zu gewährleisten.
4. Können Eltern beim Verfahren anwesend sein?
Ja. Eltern oder gesetzliche Vertreter:innen dürfen in der Regel an der Verhandlung teilnehmen und werden oft aktiv einbezogen.
5. Was macht die Jugendgerichtshilfe in Bremen?
Sie unterstützt das Gericht durch soziale Einschätzungen, begleitet die Jugendlichen während des Verfahrens und hilft bei der Umsetzung von Maßnahmen.